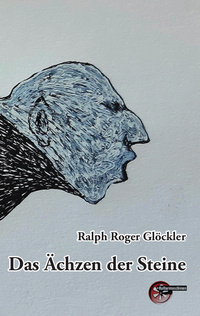Zum Buch:
Man macht im Allgemeinen einen Unterschied zwischen Kriminal- und Verbrechensliteratur. Im Krimi geht es vordergründig darum, eine auf Moral beruhende Ordnung, die durch das Verbrechen gestört ist, wiederherzustellen – wobei die besseren Vertreter des Genres die Unmöglichkeit dieses Unterfangens behandeln. Auch wenn es sich um eine Mordgeschichte handelt, darf man von Ralph Roger Glöcklers Roman Das Ächzen der Steine nichts von alledem erwarten. Dieser Text, der die Lesenden mit der psychologischen Rekonstruktion eines Mehrfachmordes an die Grenzen des Erträglichen bringt, ist Verbrechensliteratur im Sinne von Schillers Verbrecher aus verlorener Ehre und – worauf der Autor selbst hinweist – Büchners Woyzeck. Er denkt sich in einen Täter hinein und lässt ihn vom Gegenstand zum Subjekt werden, nicht um ihn zu rechtfertigen, sondern um uns die Möglichkeit zu geben, ihm gerecht zu werden.
Glöcklers Roman, der 2019 unter dem Titel Rückkehr ins Dorf schon einmal erschienen ist und nunmehr in einer überarbeiteten Version vorliegt, beruht auf einem authentischen „Fall“: 1987 tötete ein Mann offenbar während eines psychotischen Schubes innerhalb weniger Stunden mehrere Menschen. Das Besondere daran war, dass er seine Tat zuvor schriftlich aufgezeichnet hatte – in der Hoffnung, jemand möge diese Aufzeichnungen lesen und ihn davon abhalten, seine Mordpläne zu verwirklichen. Glöckler hat den Mann im Gefängnis besucht, mit seinen Verwandten und anderen beteiligten Personen viele Gespräche geführt und die Tatorte aufgesucht. Das Ächzen der Steine ist gleichwohl weder Dokumentation noch Kriminalroman, sondern eine dichte poetische Rekonstruktion der Aufzeichnungen des Mörders, die uns mitnimmt und gleichsam abgleiten lässt in die Wahnwelt eines Mannes, von dem wir am Ende wissen, dass sein Verbrechen das spiegelt, was ihm selbst widerfahren ist.
Marto ist Ehemann und Vater von drei Kindern, zwei Töchtern und einem Sohn. Besonders Rita, die sich zu einer selbstbewussten jungen Frau entwickelt, bedrängt er mit väterlicher Eifersucht und wähnt in allen jungen Männern Verführer seiner Tochter. Von seiner Frau fühlt er sich ungeliebt. Martos rigider Moralismus ist ein Panzer, mit dem er sein Ich notdürftig vor dem drohenden Zerfall schützt – ein Ich, gespalten von unerfüllten Liebeswünschen. Wie man aus den Fragmenten seiner Kindheitsgeschichte, einer zweiten Textschicht, erfährt, ist Marto unehelich geboren. Er wird zu seiner Großmutter abgeschoben, die ihn spüren lässt, dass er ein „Kind der Schande“ ist. Die Frauen, die Großmutter und die Mutter, zu der er schließlich zurückkehrt, verweigern ihm die Liebe. Er muss miterleben, wie sich seine Mutter prostituiert, um sie beide durchzubringen. Auch dies macht sie ihrem Sohn zum Vorwurf, der sich in Visionen von Gott und Maria Ersatzeltern herbeiphantasiert. Als „Sohn Gottes“ kann er das Sexuelle und das Weibliche abwehren. Martos moralische Prinzipien hindern ihn nicht daran, mit Vera eine außereheliche Beziehung einzugehen – auch in diesem sexuellen Verhältnis realisiert sich die Abspaltung des Weiblichen. In seiner schizophrenen Logik muss er die Frau, die ihm Liebe gibt, ebenso zerstören wie die Frau, die sie ihm verweigert. In albtraumhaften Szenen werden die Morde an der Geliebten, der Ehefrau und den Töchtern aus Martos Perspektive beschrieben, aber diese Szenen sind letzten Endes nur die Steigerung von Martos konsequent paranoid verschobener Wahrnehmung, die ihn in allen möglichen alltäglichen Situationen aus der Rolle fallen lässt und die schließlich gegenüber der Wirklichkeit überhandnimmt. Marto ist sich dieser Einbrüche des Wahns in die Wirklichkeit bewusst, ohne sie kontrollieren zu können.
Glöckler verzichtet auf eine Erzählerinstanz und versetzt uns vielmehr in die Position von Martos Ehefrau Luisa, die die Papiere ihres Mannes entdeckt und liest. Das Zusammenspiel der Aufzeichnungen Martos, der seinen eigenen Wahrnehmungen immer wieder misstraut, mit den Empfindungen der lesenden Luisa und den von Marto fingierten Briefe der Geliebten Vera gerät zu einem Protokoll der Verunsicherung. Grundiert wird das Geschehen von Martos Kindheitsgeschichte, auf der die Erzählung als hypothetische Vorwegnahme der Morde aufsetzt. Der Text bildet eine vielstimmige Komposition aus Chor und Solisten, die ein feines Gehör erfordert, wenn man sich beim Lesen darin orientieren will. Für die schizoide Wahrnehmungsstruktur, die dem mörderischen Geschehen ihre erbarmungslose Dynamik gibt, erfindet der Autor die Form eines Oratoriums in Prosa, das sich nicht auf eine moralische Ordnung festlegt, sondern im Zusammenspiel der Rollen mögliche Deutungen für das Unbegreifliche eröffnet. Zusammengehalten wird es vom Basso continuo einer Kindheit, der niemand entrinnen kann.
Sven Limbeck, Wolfenbüttel